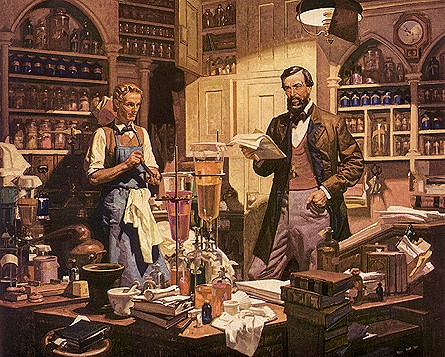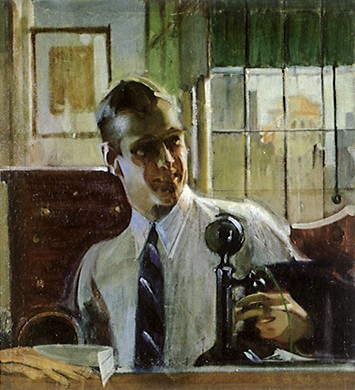Basiswissen Biologie, Chemie, Physik R-Z
Resonanz (Physik)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Als Resonanz werden in der Physik Vorgänge bezeichnet, bei denen ein schwingungsfähiges System mit seiner Eigenfrequenz durch Energiezufuhr angeregt wird. In diesem Fall beträgt die Phasenverschiebung zwischen Erreger und erzwungener Schwingung 90 Grad, der Energieübertrag auf das schwingungsfähige System ist in diesem Fall maximal. Hierdurch kann die Amplitude des angeregten Systems auf ein Vielfaches der Erregeramplitude ansteigen.
Abhängigkeit der Amplitude von der Erregerfrequenz und der Dämpfung
Die Resonanzkurve eines solchen Systems gibt seine Schwingungsamplitude in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz an. Je geringer die Dämpfung ist, desto schmaler und höher wird das Maximum der Kurve, der Resonanzpeak. In extremen Fällen kann die „Aufschaukelung“ zur Zerstörung des Systems führen (Resonanzkatastrophe).
Der genaue Verlauf der Resonanzkurve hängt von der Kopplung zwischen Erreger und Resonator ab. Die abgebildete Resonanzkurve gilt für die so genannte Kraftkopplung und die Aufhängungskopplung. Es gibt andere Kopplungsarten wie Strom-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungskopplung. In der Nähe der Resonanzfrequenz lässt sich die Amplitude durch die Lorentzkurve ausdrücken. Sie stellt die Fourier-Transformierte einer exponentiell gedämpften Schwingung dar.
Das Phänomen der Resonanz ist in der Physik weit verbreitet. Beispiele sind:
- in der Mechanik:
- Schaukel
- „aufschaukeln“ der gleichmäßigen Fußtritte einer Marschkolonne
- starke Vibrationen von Fahrzeugkarosserien bei bestimmten Motordrehzahlen (Dröhnen)
- Resonanzauspuff bei 2-Takt-Motoren zur Leistungssteigerung
- in der Hydromechanik:
- Tideresonanz
- Wellenresonanz
- Brandungsresonanz
- in der Akustik:
- die Tonerzeugung bei Musikinstrumenten (Streich- und Blasinstrumenten); auch das Mitschwingen einer nicht gespielten Saite, wenn ein gleichgestimmtes Instrument ertönt
- in der Elektrotechnik beim Schwingkreis
- in der Atomphysik:
- Resonanzfluoreszenz eines Atoms oder Moleküls bei Anregung im Lichtfeld.
- scharfe Resonanzabsorption im Lichtspektrum der Sonne (Fraunhoferlinien)
- Die stimulierte Emission von Photonen (Grundlage des Lasers) ist zwar Resonanz-ähnlich, wird aber auf die besonderen Eigenschaften der Bosonen zurückgeführt.
- in der Kernphysik:
- Kernspinresonanz des Kernspins. Bringt man einen Atomkern mit einem von Null verschiedenen Gesamtspin in ein Magnetfeld, richtet sich das aus dem Spin resultierende magnetische Moment entweder parallel oder antiparallel zum äußeren Feld aus. Dabei ist die parallele Ausrichtung energetisch bevorzugt. Der antiparallelen Ausrichtung entspricht ein geringfügig höherer Energiebetrag, der durch Einstrahlung von Radiowellen mit einer bestimmten Resonanzfrequenz aufgebracht werden kann. Das Umklappen des Kernspins aus der parallelen in die antiparallele Ausrichtung nach der Energieeinstrahlung bezeichnet man als Kernspinresonanz. Dasselbe Verhalten – Umklappen des Spins – zeigen Elektronen, was man in der Elektronenspinresonanz nutzt.
- Kernresonanz in einer Kernreaktion. Von einer Kernresonanz spricht man dann, wenn bei einem Zusammenstoß zweier Atomkerne kein neuer Atomkern entsteht, sondern nur ein extrem kurzlebiger (10-16 s) Zwischenzustand.
Selbstorganisation
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Als Selbstorganisation wird in der Systemtheorie hauptsächlich eine Form der Systementwicklung bezeichnet, bei der die formgebenden, gestaltenden und beschränkenden Einflüsse von den Elementen des sich organisierenden Systems selbst ausgehen.
Im politischen Gebrauch bezeichnet Selbstorganisation die Gestaltung der Lebensverhältnisse nach flexiblen, selbstbestimmten Vereinbarungen und ähnelt dem Autonomiebegriff.
Konkret eingesetzt wird der Begriff bei sich selbstorganisierenden Karten.
Eigenschaften
Selbstorganisierte Systeme haben i. d. R. vier Eigenschaften [1]:
- Komplexität: Sie sind komplex, wenn ihre Teile durch wechselseitige, sich permanent ändernde Beziehungen miteinander vernetzt sind. Die Teile selbst können sich ebenfalls jederzeit verändern. Komplexität erschwert es, das Verhalten von Systemen vollständig zu beschreiben oder vorherzusehen.
- Selbstreferenz: Selbstorganisierende Systeme sind selbstreferentiell und weisen eine operationale Geschlossenheit auf. Das heißt, „jedes Verhalten des Systems wirkt auf sich selbst zurück und wird zum Ausgangspunkt für weiteres Verhalten“. Operational geschlossene Systeme handeln nicht aufgrund externer Umwelteinflüsse, sondern eigenständig und eigenverantwortlich aus sich selbst heraus. Selbstreferenz stellt aber keinen Widerspruch gegenüber der Offenheit von Systemen dar.
- Redundanz: In selbstorganisierenden Systemen erfolgt keine prinzipielle Trennung zwischen organisierenden, gestaltenden oder lenkenden Teilen. Alle Teile des Systems stellen potentielle Gestalter dar.
- Autonomie: Selbstorganisierende Systeme sind autonom, wenn die Beziehungen und Interaktionen, die das System als Einheit definieren, nur durch das System selbst bestimmt werden. Autonomie bezieht sich nur auf bestimmte Kriterien, da eine materielle und energetische Austauschbeziehung mit der Umwelt weiterhin besteht.
Geschichte
Der Begriff der Selbstorganisation wurde in den 50er-Jahren von W. A. Clark und B. G. Farley geprägt:
„Sie erkannten, dass sich Operatoren, die in einer geschlossenen Beziehung stehen, irgendwie stabilisieren und beobachteten – noch ohne eine Theorie der rekursiven Funktionen oder des Eigenwertes zu kennen – das Phänomen, dass bestimmte geschlossene Systeme nach einer gewissen Zeit stabile Formen des Verhaltens entwickeln“
– Heinz von Foerster und Bernhard Pörksen: Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, 1998, S. 92.
In sozialen Systemen lässt sich beobachten, wie Ordnung – unabhängig von den Handlungen eines Organisators – aus dem System selbst heraus entsteht. Diese Erscheinung wird als Selbstorganisation bezeichnet. Die Selbstorganisation ist ein nicht nur in der Systemtheorie populärer Begriff. Ihm kommt sowohl in sozialen als auch in natürlichen, physikalischen, biologischen, chemischen oder ökonomischen Systemen Bedeutung zu. Auch geht das Konzept der Rätedemokratie und ihrer sozio-politischen Ansätze davon aus, dass die zur Selbstorganisation erforderlichen Handlungsspielräume gegen bestehende Formen der Fremdbestimmung erkämpft werden müssen. Diesem Ansatz zufolge können die Menschen nur dann ihr Leben selbst in die Hand nehmen, wenn sie auch die Produktionsmittel kontrollieren und nicht hierarchischen Organisationen unterworfen sind.
Die Vor- oder Urgeschichte der Selbstorganisation umfasst den Zeitraum vom griechisch-römischen Altertum bis etwa zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Schon im alten Griechenland spekulierten Philosophen über Chaos und Turbulenz als Ursache von Ordnung. In der Philosophie des Aristoteles könnte man Selbstorganisation auch als Entelechie bezeichnen. Die platonisch orientierte Naturphilosophie Isaac Newtons (Philosophiae naturalis principia mathematica, 1687) nimmt schon im Ersten Bewegungsgesetz an, dass die Materie absolut passiv ist. Sie ist deshalb auch zu keiner Selbstbewegung und Selbstorganisation fähig. Aktive Ursachen materieller Veränderungen sind hier die immateriellen “Kräfte der Natur”. In den Naturwissenschaften des achtzehnten, neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts dominierten dagegen materialistisch-mechanistische Denkweisen, die sich unter anderem auch in Darwins Evolutionstheorie widerspiegeln. Die eigentliche Entstehungsgeschichte der Selbstorganisation beginnt jedoch erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der relativ späte Zeitpunkt hat mehrere Ursachen, zunächst verhinderte das vorherrschende mechanistische Paradigma das notwendige Umdenken, außerdem wurden mit Selbstorganisation in Verbindung stehende Phänomene ignoriert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer Theorie selbstorganisierender sozialer Systeme oder von empirisch getesteten Hypothesen gesprochen werden.
Der universellen Anwendbarkeit verdankt der Begriff der Selbstorganisation seine breite Resonanz.
Selbstorganisation in der Systemtheorie
Selbstorganisation ist das spontane Auftreten neuer, stabiler, effizient erscheinender Strukturen und Verhaltensweisen (Musterbildung) in offenen Systemen. Das sind Systeme, die sich fern vom thermodynamischen Gleichgewicht befinden, die also Energie, Stoffe oder Informationen mit der Außenwelt austauschen. Ein selbstorganisiertes System verändert seine grundlegende Struktur als Funktion seiner Erfahrung und seiner Umwelt. Die interagierenden Teilnehmer (Systemkomponenten, Agenten) handeln nach einfachen Regeln und erschaffen dabei aus Chaos Ordnung, ohne eine Vision von der gesamten Entwicklung haben zu müssen.
Ein einfacher Fall von (physikalischer) Selbstorganisation ist z. B. das Auftreten von Konvektionszellen beim Erhitzen von Flüssigkeiten (Bénard-Experiment).
Das Konzept der Selbstorganisation findet man in verschiedenen Wissenschaftsbereichen wie z. B. Chemie, Biologie (Gerichtete Faltung und Assoziation von Proteinen, Helix-Bildung der DNA, …), Soziologie usw.
Synergetik
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Synergetik ist die Lehre vom Zusammenwirken von Elementen gleich welcher Art, die innerhalb eines komplexen dynamischen Systems miteinander in Wechselwirkung treten (bspw. Moleküle, Zellen oder Menschen). Sie erforscht allgemeingültige Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten des Zusammenwirkens, die universell in Physik, Chemie, Biologie, Psychologie und Soziologie vorkommen, auch Synergie genannt, und liefert eine einheitliche mathematische Beschreibung dieser Phänomene. Die spontane Bildung von synergetischen Strukturen wird als Selbstorganisation bezeichnet.
Die Synergetik ist in den 1970er Jahren aus der statistischen Physik der Nichtgleichgewichtssysteme hervorgegangen (Hermann Haken) und behandelte demgemäß zunächst rein physikalische Systeme, deren bekanntestes der Laser ist. An diesem paradigmatischen System der Selbstorganisation fern vom thermodynamischen Gleichgewicht konnten die wesentlichen Prinzipien, wie das Ordnungsparameter-Konzept, Versklavungsprinzip, Phasenübergänge u. a. entwickelt werden.
Das Versklavungsprinzip besagt, dass das Verhalten, also die Dynamik der Systemteile eines komplexen Gesamtsystems durch einige wenige Ordnungsparameter bestimmt wird. Damit findet verglichen zur Komplexität bei der Betrachtung eines Einzelsystems eine erhebliche Informationskomprimierung statt. Denn zur Verhaltensbeschreibung des Gesamtsystems reicht es, abhängig vom Ordnungsparameter-Raum einige wenige Gleichungen aufzustellen, die das Gesamtsystem beschreiben.
Durch die grundlegende Ähnlichkeit aller Systeme, die sich unabhängig von der konkreten Wechselwirkung aus vielen Konstituenten zusammensetzt, konnten die entwickelten Methoden auf viele andere Bereiche ausgeweitet werden. In der Chemie ist das bekannteste Beispiel die Belousov-Zhabotinsky-Reaktion, bei der man räumliche und zeitliche Muster beobachten kann.
Weitere Beispiele sind:
- Bénard– und Taylorinstabilität
- Wolkenmuster
- Hirnströme (EEG)
- chemotaktische Aktivität des Schleimpilzes
- Räuber-Beute-Systeme
- öffentliche Meinungsbildung
Synergetik wurde durch ihre breite Anwendbarkeit in interdisziplinären Bereichen teilweise auf ein Schlagwort reduziert, das nicht mehr als eine Gemeinschaftswirkung bedeutet, die über die Summe der Leistungen der Einzelnen hinausgeht. Die Synergetik ist jedoch eher eine mathematisch exakt formulierte Theorie als philosophische oder wissenschaftstheoretische Position.
Synergetik nach Haken
Lasertheorie
Die Arbeiten von Albert Einstein zur stimulierten Emission führten zu der Überlegung, dass Lichtverstärkung möglich ist, welche durch gegenseitig angeregte Emission von Photonen bedingt wird. 1960 wurde erstmals Laserlicht in Form eines Rubinlasers erzeugt, seither wurden zahlreiche andere Medien nutzbar gemacht. Hermann Haken entwickelte kurze Zeit später eine Lasertheorie, welche als eine Theorie der komplexen Systeme, im speziellen als eine Theorie der Selbstorganisation aufgefasst wird – also der Entwicklung von Systemzuständen ohne äußeren Zwang (selbstorganisiert), die nicht präzise vorhergesagt werden können (komplex). Ein Ziel der Lasertheorie besteht neben der verständlichen Erklärung der physikalischen Vorgänge insbesondere darin, den zeitlichen Verlauf der Atomzustände berechnen und mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit das Verhalten von Laserlicht-Atomen vorhersagen zu können.
Der entscheidende Phasenübergang (Zustandswechsel) von Licht mit einer Überlagerung von zahlreichen Wellenlängen in Laserlicht ist die Laserschwelle: Wenn jene überschritten wurde, beginnen die Atome des Lasers damit, im Gleichtakt zu schwingen und Licht von nur annähernd einer Wellenlänge auszusenden. Gegenüber Licht mit zahlreichen Wellenlängen, z.B. dem Licht einer Glühlampe, ist Laserlicht in hohem Maße räumlich kohärent.
Einzelne Systemzustände werden meist mittels Differentialgleichungen beschrieben. Durch die Verhältnissetzung der jeweiligen Zustandsgleichung mit ihrer zeitlichen Ableitung kann, bei vollständiger Kenntnis des gegenwärtigen Zustandes, mit Einsetzen von Variablen jeder mögliche zukünftige Zustand berechnet werden. Bei komplexen Systemen wie dem System von Licht und Medium sind die Gleichungen häufig gekoppelt, d.h. die Wechselwirkungen der Atome werden durch die gegenseitige Abhängigkeit der Variablen in den Gleichungen in mathematische Formeln „übersetzt“. Der annähernde Gleichtakt der Atomschwingungen im Laserlicht ermöglicht hierbei eine erste Vereinfachung der Berechnung, da die Lichtwellen nicht viele verschiedene Wellenlängen, sondern annähernd eine einzige besitzen. Hierdurch werden für die Auflösung der Differentialgleichungen zur Beschreibung der möglichen Systemzustände zu einem bestimmten Zeitpunkt lediglich drei Variablen benötigt:
- bλ beschreibt die zeitabhängigen Amplituden der möglichen elektromagnetischen Schwingungszustände, auch Moden genannt (λ bezeichnet den Index der Moden, also b1, b2, b3, …)
- dµ drückt die atomare Inversion aus, also die Differenz der Besetzungszahlen der Energieniveaus, in denen die laseraktiven Atome sich befinden können (µ ist der Index für die einzelnen Atome, also d1, d2, d3…)
- αµ beschreibt die Dipolmomente der einzelnen Atome.
Die Vorgänge, die durch diese Variablen beschrieben werden, sind stark ineinander verzahnt, d.h. sie sind hochgradig voneinander abhängig und reagieren aufeinander. Mit den Methoden der fundamentalen physikalischen Theorien können die komplexen Differentialgleichungsysteme nicht gelöst werden, weil diese im Gegensatz zur statistischen Physik größtenteils Lösungen für verhältnismäßig einfache Systeme mit wenigen Bestandteilen entwickelt haben. Hakens Ansatz der Lasertheorie, den er später zu Synergetik verallgemeinert hat, ermöglicht die Auflösung von extrem vielen und verkoppelten Differentialgleichungen, die hier vereinfacht dargestellt wird:
Ausgangspunkt der Lasertheorie nach Haken ist die Feststellung, dass verschiedene Prozessgeschwindigkeiten existieren, sich die Variablen also in unterschiedlichen zeitlichen Abständen verändern: bλ ändert sich am langsamsten, etwas langsamer verändert sich dµ, am schnellsten tritt bei αµ eine Änderung auf. Auf Basis dieses Unterschiedes wird eine Hierarchie aufgestellt, in der bλ am höchsten steht. Es wird als sog. Ordnungsparameter aufgefasst, welcher die anderen beiden Variablen „versklavt“, sich also alle anderen Variablen an Ordnungsparameter ausrichten und in ihren Veränderungen von diesem bestimmt werden. Dabei ist es ein grundsätzliches Prinzip der Synergetik nach Haken, dass sich der Zustand und der zeitliche Verlauf eines Systems durch sich langsam ändernde Variablen treffend beschreiben lässt, weil sich schneller ändernde Variablen so aufgefasst werden, dass sie sich an den langsamen „orientieren“. In der Berechnung gilt bλ hierdurch als zeitlich konstant, die „versklavenden“ bλ bestimmen nach Haken den Zustand bzw. den Zahlenwert von dµ und αµ.
Im Vokabular der Synergetik gewinnt ein einzelnes b (z.B. b239) den Wettbewerb unter den Ordnungsparametern und gibt den Takt der Schwingungen vor, wodurch sich die einheitliche Grundmode, die sich mittels Symmetriebrechung im System von Laserlicht und Medium ausbildet, allein durch das taktgebende b berechnet werden kann. Durch diesen sog. Einmodenfall in Kombination mit der Annahme eines herausgehobenen, den Systemzustand bestimmenden Ordnungsparameters vereinfachen sich die Differentialgleichungen derart, dass sie gelöst werden können. Physikalisch betrachtet folgen die Atome in einem Laser also im Sinne der Synergetik nach Haken augenblicklich den Vorgaben des taktgebenden Ordnungsparameters nach der Methode der adiabatischen Näherung.[1]
Kritik an der postulierten Kausalität
Nach Achim Stephan schließt der Synergetik-Ansatz nach Haken ohne weitere Begründung von einer empirisch gut geprüften und mathematisch fundiert formulierten, beschreibenden These auf eine kausaltheoretische These. Zwar lassen sich mit der Auffassung von Ordnungsparamtern und dem Versklavungsprinzip verschiedenste Vorgänge mathematisch zutreffend beschreiben und mit hoher Wahrscheinlichkeit vorausberechnen, jedoch begehe Haken in diesem Fall einen Fehlschluss der Art post hoc, ergo propter hoc: Obwohl das spätere Verhalten des Gesamtsystems im Voraus gut an den Ordnungsparametern abgelesen werden kann, könne man hieraus jedoch nicht automatisch schließen, dass die als repräsentativ anerkannten Parameter auch das Systemverhalten ursächlich festlegen. Insbesondere in sozialen Systemen sei die Anwendung der kausaltheoretischen These problematisch, z.B. „versklave“ das Betriebsklima nicht das Verhalten eines Mitarbeits bzw. das „[…] Betriebsklima tut gar nichts.“[2]
Zudem sei ungeklärt, wie Hakens Rede von ,zirkulärer Kausalität‘ zwischen einem für das Gesamtsystem repräsentativen Ordnungsparameter und den (übrigen) Systembestandteilen verstanden werden kann: Entweder als kausale Wechselwirkungen innerhalb der Ebene der Systembestandteile oder als kausale Wechselwirkungen zwischen der Ebene der Systembestandteile und der Ebene des Gesamtsystems. Im letzteren Fall würde es sich um eine besondere Variante von Abwärtskausalität handeln, da dasselbe Einzelbestandteil (Ordnungsparameter), auf welches im Sinne der Synergetik nach Haken das Verhalten des Gesamtsystems kausal zurückgeführt wird, zugleich von der Ebene des Gesamtsystems aus wieder auf die Einzelbestandteile kausal einwirken würde.[1]
Thermisches Gleichgewicht
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Begriff thermisches Gleichgewicht wird in zwei verschiedenen Zusammenhängen benutzt.
Zum einen im oben verwendeten Sinne als Zustand eines einzelnen thermodynamischen Systems: Es befindet sich im thermischen Gleichgewicht, wenn es durch einige wenige makroskopische Größen beschrieben werden kann und wenn sich diese Größen zeitlich nicht ändern. Eine Flasche Schnaps im Kühlschrank befindet sich im thermischen Gleichgewicht, weil ihr Zustand durch Masse, Temperatur, Druck und Alkoholgehalt eindeutig bestimmt ist und (oft) über längere Zeit konstant bleibt. Ein Liter kochendes Spaghettiwasser befindet sich nicht im thermischen Gleichgewicht, weil für die Beschreibung seiner turbulenten Strömungsbewegung sehr viele Informationen erforderlich sind und es deshalb im strengen Sinne kein thermodynamisches System ist.
Zum anderen als Beziehung zwischen mehreren Systemen: Zwei Körper, die miteinander in thermischem Kontakt stehen, befinden sich miteinander genau dann im thermischen Gleichgewicht, wenn sie die gleichen Temperaturen besitzen. Ist ein System A sowohl mit einem System B als auch mit einem System C im thermischen Gleichgewicht, dann sind auch die Systeme B und C miteinander im thermischen Gleichgewicht. Diese Aussage bildet eine wichtige Grundannahme der Thermodynamik und wird zuweilen als Nullter Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet.